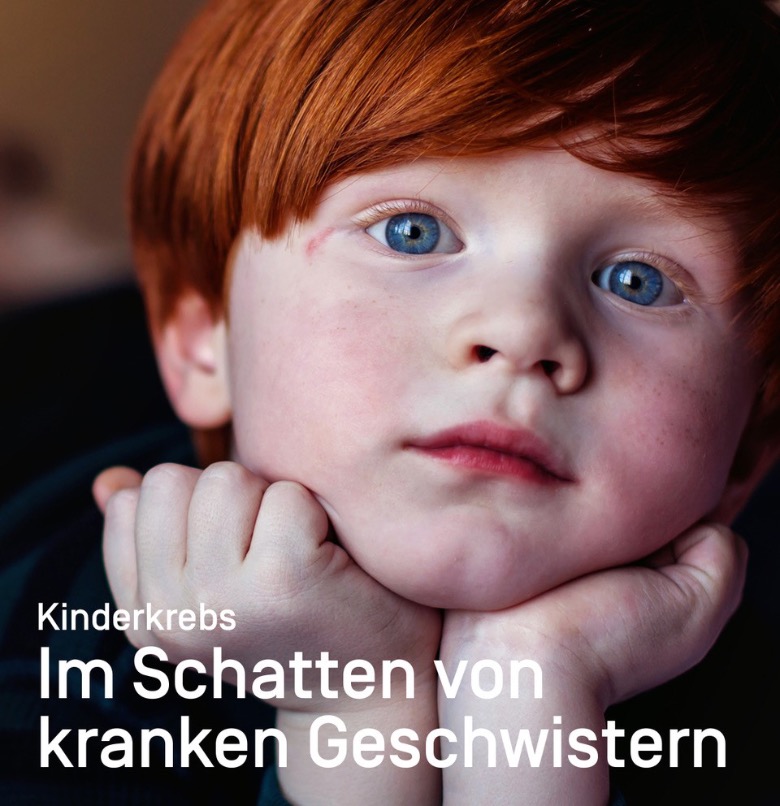Andrea hat zwei Töchter. Die jüngere erkrankte an Krebs. Die ältere trug das Familienschicksal mit. Wie erging es der Familie mit der Krebsdiagnose ihres Kindes? Wie hat sich Andrea selbst durch diese Zeit gebracht und wie ihre Familie? Im Tadah Interview erzählt sie ehrlich und direkt. Wir danken von Herzen.
Andrea Meyer* ist Mutter zweier Mädchen und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie möchte gerne anonoym bleiben.
kinderkrebs-schweiz.ch
Tadah: Liebe Andrea. Isabelle hat sich nie über ihre Krankheit definiert, deshalb möchtest Du Isabelle auch nicht in die Öffentlichkeit stellen.
So ist es. Ich erzähle meine Geschichte, das ist wichtig. Aber ich möchte es anonym tun. Der eine Grund dafür ist, dass meine an Krebs erkrankte Tochter Isabelle. Sie ist heute 9 Jahre alt und hat sich nie über die Erkrankung definiert, obwohl sie zwei Jahre lang in einer intensiven Behandlung war – samt Operation, Chemo und Bestrahlung. Dabei verlor sie sämtliche Haare, auch die Augenbrauen, und sass kurze Zeit im Rollstuhl und hatte Krücken. Sie wünscht sich nichts mehr, als «ein normales Mädchen» zu sein, wie sie selbst sagt. Ich möchte sie gerne in ihrem Wunsch unterstützen und sie vor Stigmatisierungen schützen.
Und der zweite Grund?
Der zweite Grund bin ich selbst. Mein Mann und ich haben von Anfang an die Erkrankung sehr offen in unserem beruflichen und privaten Umfeld kommuniziert. Einerseits, weil Kinderkrebs relativ unbekannt ist und wir mithelfen möchten, diese Krankheit zu enttabuisieren. Andererseits weil wir auch von unseren Arbeitgebern während langer Zeit auf viel Verständnis, Homeoffice und mehr angewiesen waren.
Und doch ist Krebs nicht so eine Erkrankung wie eine andere, es ist kein Beinbruch und auch nicht Diabetes. Krebs, gerade bei Kindern, kann sehr viel auslösen. Einige sind schockiert, gerade Eltern mit eigenen Kindern. Wir haben es bei ganz wenigen Leuten auch erlebt, dass sie sich von uns abgewandt haben. Ich nehme mir meine Tochter zum Vorbild und möchte auch nicht mein Leben lang einfach «s’Mami vom krebskranken Kind» bleiben.
Der Tod ist bei so einer Diagnose einfach präsent.
Verständlich. Schützt Du Dich so auch vor ungebetenen Ratschlägen?
Wisst Ihr: Krebs ist sehr vielfältig und die Auslöser sind nicht so gut erforscht. Es sterben halt viele Menschen an Krebs. Der Tod ist bei so einer Diagnose einfach präsent. Das gibt Anlass zu vielen Spekulationen, vor allem bei Menschen, die vielleicht nicht so gut mit Unsicherheiten leben können und sich gerne eine einfach, möglichst monokausale Erklärungen haben. Ich wurde schon mit allem möglichen Quatsch konfrontiert, von Menschen, die mir ungefragt erklärt haben, was den Krebs meiner Tochter ausgelöst haben könnte und wie er zu heilen sei. Davor möchte ich mich schützen und steuern, wem ich davon erzähle und wem eben nicht.
Unglaublich. Man sollte denken, das traut sich niemand?
Das geht nicht nur anderen gegenüber so, sondern auch sich selbst. Krebs steckt ja als Veranlagung in uns allen, also als Tendenz, dass Zellen mutieren und sich unkontrolliert vermehren. Ich habe gestandene Frauen erlebt, die nach der Diagnose Brustkrebs fest glauben, dass eine Art ungelöste Probleme oder unverarbeitete Emotionen ihren Krebs ausgelöst haben. Dann hat man neben der Erkrankung auch noch diese Schuld zu tragen. Sie laden sich selbst zusätzlich die Bürde auf, es selbst verursacht zu haben. Vielleicht eine Form von Selbstüberschätzung.
Die Krebsdiagnose eines Kindes stellt das Leben aller Familienmitglieder auf den Kopf. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Den meisten Eltern bleibt kaum noch Zeit und Kraft für die Geschwisterkinder, die so meist im Schatten ihrer kranken Schwester oder ihres kranken Bruders stehen. Und mitleiden. Häufig still und unbemerkt. Um zu verhindern, dass Geschwisterkinder unter langfristigen psychischen Folgen leiden, benötigen sie ein aufgeklärtes Umfeld, das sie begleitet und unterstützt. Es gilt, ihre Bedürfnisse wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken und ihnen Bewältigungsstrategien an die Hand zu geben.
Kinderkrebs Schweiz klärt über Risiken und Lösungswege aus der Krise auf. Das Augenmerk der aktuellen Sensibilisierungskampagne liegt auf den Geschwisterkindern – wie sie in diesen Ausnahmesituationen reagieren und was sie brauchen.
kinderkrebs-schweiz.ch
Lass uns das Rad der Zeit kurz zurückdrehen in die Zeit, bevor Deine Tochter die Krebs-Diagnose erhielt.
Isabelle war fast 7, Naomi 10. Und ich habe ungefähr 70% gearbeitet, habe meinen Job geliebt, ging in der Freizeit gerne Wandern oder ins Museum. Die beiden Kinder waren kerngesund, hatten Hobbies, Freundinnen. Eine normale Schweizer Familie halt.
Im Sommer 2019 hatte Isabelle dann plötzlich Symptome?
Genau. Isabelle hatte einen Weichteiltumor und ihn bei sich selbst bemerkt. Damals war sie knapp sieben Jahre alt. Ich war schockiert, wir gingen sofort zum Kinderarzt und wurden eine Woche später ins Spital überwiesen. Es war relativ schnell klar, dass es Krebs ist. Zuerst hatten wir noch gehofft, dass der Tumor gutartig ist. Aber: Er war bösartig und schnell wachsend. Das hat uns zutiefst schockiert. Und unser Umfeld ebenso.
Wie hast Du als Mutter diese Diagnose aufgenommen?
Ich habe zum ersten Mal verstanden, was Majestix damit meint, wenn er sagt, «der Himmel fällt mir auf den Kopf». Genau so habe ich mich gefühlt, während Monaten. Ich stand unter Schock, hatte ein Gefühl, wie in Watte gepackt zu sein, oder nur noch zu funktionieren. Nach ein paar Wochen merkte ich plötzlich wieder, dass der Wind über meine Haut strich und die Sonne sie erwärmte – dann merkte ich erst, dass ich das über Wochen gar nicht gefühlt hatte.
Wie ging es Deinem Mann?
Uns war beiden klar, dass wir mit allen Mitteln unsere beiden Töchter unterstützen und alles andere hinten anstellen. Mein Mann und ich haben beide auch körperlich reagiert auf die Diagnose: Er hatte eine starke Magenentzündung entwickelt und bei mir schwollen die Lymphknoten in den Achseln an.
Meine jüngere Tochter fragte, als wir zum ersten Mal auf der Kinderonkologie im Spital waren, ob auf dieser Abteilung auch Kinder sterben.
Und Isabelle selbst?
Isabelle und auch ihre Schwester Naomi waren beide eher gefasst – fast schon pragmatisch. Vielleicht konnten sie in diesem Moment auch das Ausmass der Diagnose und die bevorstehende Behandlung nicht erfassen. Die kindliche Perspektive ist ja viel eher auf den Moment gerichtet. Das ist immer wieder ein Anstoss für mich, dass ich mich selbst nach dieser kindlichen Perspektive richte und einfach versuche, den Moment zu geniessen. Meine jüngere Tochter fragte, als wir zum ersten Mal auf der Kinderonkologie im Spital waren, ob auf dieser Abteilung auch Kinder sterben. Das hat mich sehr getroffen, aber ich wollte sie nicht belügen und bejahte. Als der Arzt von der Chemotherapie sprach, stellte sich Isabelle darunter zuerst eine Art Physiotherapie mit Übungen vor. Das hat sie mir erst kürzlich erzählt.
Als Familie haben wir einfach von Anfang an gesagt: Wir schaffen das zusammen, wir gehen jetzt gemeinsam da durch, egal was kommt und was das Schicksal uns abverlangt.
Das gesunde Kind, Naomi, wie hat sie diese Situation weiterhin gemeistert?
Für Naomi war wohl die Unsicherheit schwierig, in der wir ja alle steckten. Nicht zu wissen, wie es herauskommt und trotzdem weiter funktionieren müssen oder sogar noch besser funktionieren müssen.
Es ist nicht so einfach als Eltern, wenn man gerade selbst so überwältigt ist von einer Situation, genau zu verstehen, was in den Kindern abgeht. Wir steckten ja selbst auch in einem Gefühls-Mix drin. Wir haben immer wieder versucht, passende Worte dafür zu finden. Ich habe bei uns auf den Küchentisch so Gefühlskärtli hingestellt, die uns halfen. Wir erzählten uns auch immer unsere Träume und malten zusammen, das half und hilft noch, wenn man manchmal keine Worte findet.
Als Familie haben wir einfach von Anfang an gesagt: Wir schaffen das zusammen, wir gehen jetzt gemeinsam da durch, egal was kommt und was das Schicksal uns abverlangt.
Warst Du wütend?
Nein, nicht per se. Zuerst war da Trauer und Verzweiflung, später Hoffnung. Und mittlerweile am ehesten Dankbarkeit.
Seltsam, ich wurde ganz oft auf das Gefühl Wut angesprochen. Einmal wurde ich sogar konkret aufgefordert, ich solle doch jetzt meine Wut äussern, ohne dass die Person gefragt habe, ob ich überhaupt wütend bin. Das ist eben auch das, was ich meine mit sublimer Stigmatisierung. Das Umfeld denkt, wir müssten uns jetzt doch so oder so fühlen, ohne offen zu sein dafür, wie wir uns wirklich fühlen.
Was mich wütend machte, waren Situationen, in denen Menschen sich nicht so verhielten, wie ich erwartet hatte.
Beispielsweise?
Zum Beispiel als der humanoide Schulroboter, der in der Schweiz vor ein paar Jahren als Prototyp im Einsatz war, aus Kostengründen nicht bewilligt wurde. Isabelle hätte mit ihm virtuell am Schulunterricht teilnehmen können. So war Isabelle über ein Dreivierteljahr von der Schule ausgeschlossen. Die Lehrerin brachte zwar das Schulmaterial zu uns nach Hause, und im Spital gab es auch eine Lehrerin, aber eben nur, wenn wir stationär waren.
Von mir aus gesehen ist die Integration von schwer kranken Kindern in die Schule noch eine grosse Baustelle. Hoffentlich hat die Pandemie mitgeholfen, dass wir jetzt endlich die technischen Hilfsmittel, die es ja schon lange gibt, in Anspruch nehmen.
Isabelle blieb neun Monate mit mir daheim. Ziemlich doof für ein siebenjähriges aufgewecktes Mädchen.
Gab es damals überhaupt einen «normalen» Alltag?
Während der Intensivtherapie durfte Isabelle nicht in die Schule, weil sie immunsupprimiert war. Das heisst, sie blieb also neun Monate mit mir daheim. Ziemlich doof für ein siebenjähriges aufgewecktes, lebensfreudiges und kontaktfreudiges Mädchen. Sie hatte neun intensive Chemoblöcke, da sie von Anfang an in der höchsten Risikogruppe war, wegen der Bösartigkeit ihres Tumors. Meistens gingen wir dafür am Donnerstag ins Spital und konnten dann am Sonntagabend wieder heimkommen.
Naomi ging weiterhin normal in die Schule, nach der Schule fuhr sie mit dem Bus zu uns ins Spital. Wenn Isabelle zwischendurch Fieber hatte, mussten wir innert einer Stunde ins Spital. Somit konnten wir überhaupt nicht planen, sondern die Erkrankung gab uns allen den Fahrplan vor. Uns als Familie, und auch den Ärzten, die den Behandlungsplan danach richten musste, wie Isabelles Körper reagiert. Ein Arzt sagte zu Beginn der Behandlung: «Es gibt einen Plan für die Behandlung, aber Isabelles Körper gibt uns den konkreten Fahrplan vor». Genauso haben wir auch als Familie funktioniert, dass immer die Genesung, und zwar nicht nur vom Krebs, sondern wir alle als Familiensystem, die Taktgeberin war.
Wie erging es Isabelle während der Chemo?
Sie hat nie mit ihrem Schicksal gehadert, sofern dies Kinder das überhaupt tun. Manchmal hatte ich den Eindruck, Isabelle sieht das Ganze als Abenteuer. Ich versuchte, es wie sie zu machen und es auch als Abenteuer zu sehen, ohne die ganze emotionale Komponente. Wir haben uns gemeinsam auf das Gute fokussiert, haben einen Ipad gekauft fürs Spital und Netflix abonniert, sie durfte zum ersten Mal auch ein paar tolle Games runterladen. Sie hatte zwei beste Freundinnen aus dem Kindergarten, die sie im Spital und Daheim besuchten. Viele Leute aus dem Umfeld brachten Nützliches für die Spitalzeit mit: tolle Brettspiele, Bastelsachen, schöne Malstifte. Auch im Spital gab es vieles, das uns den Alltag erleichterte.
Aber gerne ging sie trotzdem nicht hin, oder?
Nein. Natürlich hatte Isabelle überhaupt keine Lust, wieder ins Spital einzurücken, zur Chemo oder zu sonst einer Behandlung oder zur Bestrahlung zu gehen. In diesen Momenten habe ich sie unterstützt und versucht, ihr Leben rundherum so angenehm wie möglich zu machen. Und auch eine Perspektive zu bieten, was danach wieder möglich war. Schwierig war auch die Erhaltungstherapie, da musste sie täglich grosse Tabletten schlucken, was bei ihr oft einen Brechreiz hervorrief, schon nur wenn sie die Tablette sah, musste sie manchmal erbrechen. Da haben wir gemeinsam alle möglichen Tricks angewendet, damit das klappte. Und Isabelle hat dabei wohl auch sehr gut gelernt, wie sie willentlich etwas Mühsames umsetzen kann, wie sie durchhalten kann.
Und Naomi? Was hat die Chemo ihrer Schwester mit ihr selbst gemacht?
Für Naomi war es ein grosser Schlag, dass ihre Schwester plötzlich ins Spital musste und wir auch nicht wussten, wann und ob sie heimkommen würde. Sie mochte gar nicht mehr spielen, das alles machte für sie keinen Sinn mehr ohne ihre engste Spielpartnerin und Verbündete. Isabelle wurde von unserem Umfeld mit Geschenken und guten Wünschen überhäuft. Wahrscheinlich war Naomi auch eifersüchtig – zu Recht! Aber als damals 10-Jährige konnte sie ihre eigene Gefühle schon gut hintenanstellen, und die Sorge um ihre Schwester war bestimmt stärker. Sie wusste ja auch, dass für Isabelle jetzt all die Geschenke und Umsorgungen notwendig war, und sie sah ja auch, dass ihre Schwester so viele unangenehme Behandlungen mitmachen musste.
Ein toughes Mädchen also?
Naomi hat ihre jüngere Schwester und auch uns unterstützt, wo sie nur konnte. Darum hat sie niemand gebeten, das wollte sie einfach von sich heraus. Im Spital hat sie ihrer jüngeren Schwester geholfen, Lesen zu lernen. Sie hat sie unterstützt beim Tabletten schlucken. Sie hat ihr vorgelesen. Sie wurde auf einen Schlag viel selbstständiger, fuhr selbst Bus, hat selbst gekocht oder auch viel Zeit alleine beim Lesen verbracht. Insgesamt hat sie sich von vielen Freundinnen zurückgezogen, sie wollte einfach bei der Familie sein.
Wir haben halt einfach eine neue Normalität definiert.
Wie schafft man es, für das gesunde Kind, einen ebenso gesunden Alltag zu schaffen, der nicht nur von der Krankheit des Geschwisterkindes geprägt wird?
Ich hätte oft gerne ein Handbuch dafür gehabt. Die Erkrankung und der Schock sind halt Tatsachen, die kann man nicht wegzaubern. Und auch der mögliche Tod eines Kindes ist eine Tatsache. In der Schweiz stirbt jede Woche ein Kind an Krebs, es ist die zweithäufigste Todesursache. Und jedes Jahr werden in der Schweiz 300 Kinder neu mit Krebs diagnostiziert.
Was half denn?
Die Kinder wollten Normalität, sie wollten mit anderen spielen oder an Anlässen teilnehmen. Das haben wir so gut es geht ermöglicht, manchmal mit viel Fantasie und Improvisation. Wir haben halt einfach eine neue Normalität definiert, und andere Dinge, wie in die Badi gehen oder in die Ferien fahren als weniger attraktiv für uns dargestellt, oder einfach auf später verschoben.
Mir selbst haben konkrete Angebote sehr geholfen.
Gibt es ein Patentrezept für Hilfe aus dem Umfeld?
Nein, es gibt kein Patentrezept dafür, wie sich Menschen verhalten sollen. Am ehesten: So ehrlich und authentisch wie möglich, und zum Beispiel die eigene Unsicherheit und Betroffenheit äussern. «Das macht mich sehr betroffen, ich weiss gar nicht was sagen. Ich würde euch gerne unterstützen, aber weiss nicht, wie.» Oder auch zu hören: «Wir als Familie mit einem gesunden Kind können uns gar nicht vorstellen, wie das sein muss für euch».
Mir selbst haben konkrete Angebote sehr geholfen: Die Nachbarinnen, die angeboten haben, gekochtes Essen vorbeizubringen. Die betroffene Familie ist der innere Kern, welcher die Hauptaufgaben übernimmt. Und darum herum sind weitere Ringe von Mithilfe, die erweiterte Familie, die Ärzte und sonstigen Spezialisten, danach kommt die Schule, die Freunde.
Wie war es im Spital?
Es war schön und überraschend zu spüren, wie professionell – auch auf menschlicher Ebene – sämtliche Mitarbeiter mit uns umgingen. Und zwar vom Chefarzt bis zur Putzfrau. Alle waren sehr liebevoll, haben immer zuerst Isabelle begrüsst, dann uns, haben kindergerechte Sprache verwendet, haben die ganze Familie miteinbezogen und mitbedacht, haben auch unsere Emotionen aufgenommen, auf alle unsere «blöden» Fragen geantwortet, haben viel Zeit eingesetzt für den Aufbau von Vertrauen. Ich empfand es als sehr ganzheitlich. Das ist, weil sie geschult sind und wissen, was auf die Familie zukommt.
«Gesunde» Familien können sich das eher nicht vorstellen, was so eine Erkrankung bedeutet, und können entsprechend auch nicht einfühlsam reagieren. Vielleicht ist das auch eine gesunde Abwehrreaktion, dass man sich als gesunder Mensch nicht mit möglichen Erkrankungen, dem eigenen Tod oder dem Tod des eigenen Kindes auseinandersetzt.
Ich spüre inzwischen sehr genau, welche Menschen mir im Moment guttun und welche nicht. Und kann das entsprechend steuern, zu wem ich Kontakt haben möchte. Das war aber ein Lernprozess in den letzten zweieinhalb Jahren. Von Anfang an merkte ich, dass ich das nicht alleine schaffe und um Hilfe bitten musste, mein Umfeld aber auch in Bezug auf professionelle Hilfe. Und je genauer ich um das bitten konnte, was ich brauchte, desto höher sind auch die Chancen, dass sich das erfüllt, was ich brauche.
Als die Erhaltungstherapie im Januar 2020 fertig war, haben wir alles aus der «Krebszeit» in eine grosse Kiste gepackt: Die Perücke, die Behandlungspläne, die Glückwunschkarten, die Chemokette.
Wann ging es aufwärts?
Es ging zum ersten Mal aufwärts, als wir nach einigen Monaten wussten, dass die Chemo anschlägt und der Tumor kleiner wurde. Dann stand aber noch die Operation, die Bestrahlung, weitere Chemoblöcke und ein Jahr Erhaltungstherapie bevor. Die Operation dauerte acht Stunden, verlief aber zum Glück sehr gut. Ab da ging es nochmals aufwärts. Als die Erhaltungstherapie im Januar 2020 fertig war, haben wir alles aus der «Krebszeit» in eine grosse Kiste gepackt: Die Perücke, die Behandlungspläne, die Glückwunschkarten, die Chemokette. Da gucken wir manchmal rein. Und sind froh, dass wir die Krebskiste wieder schliessen können.
Wir haben jeden kleinen Schritt, den wir abgeschlossen hatten, gefeiert mit Kindersekt und Kuchen, manchmal mit Freundinnen oder Familie. Und für jede Behandlung habe ich einen Countdown für Isabelle gezeichnet, da konnte sie die Tage abstreichen, die sie erfolgreich hinter sich gebracht hatte.
Liebe Andrea. Wie bist Du selbst als Mutter stark geblieben?
Ich habe mich auf das Ziel fokussierte, dass ich meine Tochter durchbringen will – und zwar physisch und psychisch. Ich hatte oft das Bild, dass sie eine Extremsportlerin ist, die jetzt beispielsweise auf den Mount Everest steigen muss. Sie muss das alleine machen und hat es nicht selbst gewählt, ich muss sie ziehen lassen. Aber ich als Mutter kann dafür sorgen, dass sämtliche Bedingungen stimmen, körperlich und mental. Ich kann auch dafür sorgen, dass das Team um sie herum stimmt.
Du musstest nie die Starke spielen?
Doch. Die Herausforderung fand und finde ich noch immer, einerseits selbst so verunsichert zu sein und mir riesigen Sorgen zu machen um meine Tochter, und andererseits die «starke Mutter» gegenüber meinen beiden Töchtern zu sein. Ebenso herausfordernd war, einen Raum zu finden, wo ich eben nicht die starke Mutter sein muss. Das war für mich die Psychoonkologin, zum Teil auch die Ärzte, bei denen ich meine Befürchtungen äussern konnte und meine Ängste. Ich wurde sehr gut von ihnen aufgefangen. Als Kinderärzte wissen sie, dass sie nicht nur die Kinder heilen, sondern auch die Sorgen und Ängste der Eltern auffangen und so lenken müssen, dass die Eltern eine Hilfe sind für die Kinder.
Ich möchte aber alle Mütter ermutigen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, welche sie brauchen, auf allen Ebenen.
Was waren Deine Anker?
Für mich selbst hatte ich drei Pfeiler, um selbst zu überleben: Essen, Schlafen, Bewegung. Jeden Tag wollte ich diese drei Dinge für mich machen, ich nahm beispielsweise die Yogamatte mit ins Spital, ich fragte bei Freundinnen, ob sie mir feine Mahlzeiten ins Spital bringen, ich achtete auf genügend Schlaf. Nach den zwei intensiven Jahren fiel ich in ein Loch, da war meine Luft raus. Dann hatte ich Hilfe von der Psychoonkologin, momentan nehme ich auch Medikamente. Das ist immer noch stigmabehaftet, dass man Medikamente nimmt für die Psyche, und die Angst vor Abhängigkeit ist gross. Auch deshalb möchte ich anonym bleiben. Es wäre schwierig für mich, wenn das mein berufliches Umfeld wüsste, dass ich momentan Medis brauche. Ich möchte aber alle Mütter ermutigen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, welche sie brauchen, auf allen Ebenen. Ich brauche Zeit, um selbst wieder auf die Beine zu kommen. Dafür rechne ich mindestens zwei Jahre, also so lange, wie die anstrengende Zeit gedauert hat.
Du hilfst jetzt bei der Unterstützung von anderen betroffenen Eltern mit. Hilft Dir das auch selbst?
Ich teile gerne, was uns damals geholfen hat. Das ist für mich eine Möglichkeit, eine Art persönlichen Sinn in der Erkrankung meiner Tochter zu finden.
Wie geht es Euch jetzt?
Uns geht es momentan glücklicherweise sehr gut. Die Kinder haben ganz normale Zukunftspläne wie andere auch, sie haben Berufswünsche wie Schauspielerin, Detektivin, Managerin oder Designerin.
Ich konnte meine Arbeit glücklicherweise behalten, sie bedeutet mir noch immer viel und gibt mir Halt und eine Perspektive.
Ich habe im Job von 70% auf 30% reduziert, sonst würde es nicht gehen mit den diversen Nachsorgeterminen, die wir noch haben, und der Kommunikation mit Schule.
Die unbezahlte Care Arbeit von Müttern schwerkranker Kinder ist enorm hoch, und es sind eben meistens die Mütter, damit möchte ich den Einsatz von Vätern nicht schlecht reden.
Isabelles Erkrankung hat die Rollen wieder neu verteilt?
Jein. Sie hat verursacht, dass ich mein Arbeitspensum verringern musste, und mein Mann eine günstige Gelegenheit packte und sein Arbeitspensum erhöhte. Für mich ist diese Situation wieder «back do zero», also als unsere Kinder ganz klein waren und ich vor allem zu Hause war. Erst als meine jüngere Tochter in den Kindergarten kam, habe ich mein Arbeitspensum erhöht und konnte ungefähr gleich viel arbeiten wie mein Mann.
Von vielen anderen Eltern mit einem krebskranken Kind höre ich, dass die Mutter ihren Job ganz aufgibt und sich nur noch um die Pflege des Kindes kümmert. Die unbezahlte Care Arbeit von Müttern schwerkranker Kinder ist enorm hoch, und es sind eben meistens die Mütter, damit möchte ich den Einsatz von Vätern nicht schlecht reden. Es würde mich interessieren, ob es Studien dazu gibt, wie sich die Erkrankung eines Kindes auf die berufliche Laufbahn einer Mutter auswirkt – sicher nicht so positiv.
Mein Mann hat ein halbes Jahr nach der Diagnose eine neue Stelle erhalten und sein Arbeitspensum erhöht. Das ist super für uns wegen des höheren Lohn. Denn: Die Erkrankung bedeutet für uns schon sehr viele Mehrausgaben, obwohl wir bis jetzt die Medikamente oder Behandlungen nicht selbst bezahlen mussten.
Das Wissen darum, dass der Krebs jederzeit wieder aktiv werden könnte und wie ein Schwert auf uns runterfallen könnte. Damit müssen wir umgehen.
Kannst Du wieder unbeschwert sein?
Ja, immer wieder. Aber die Erkrankung wird immer Teil von uns bleiben, auch die Nähe zum Tod, die wir dadurch haben. Und das Wissen, dass wir Geliebtes, oder sogar geliebte Menschen unerwartet verlieren könnten. Es gibt etwas, das man «Damokles-Syndrom» nennt: Das Wissen darum, dass der Krebs jederzeit wieder aktiv werden könnte und wie ein Schwert auf uns runterfallen könnte. Damit müssen wir umgehen.
Uns tut das Zusammensein mit anderen Kinderkrebs-betroffenen Familien gut, um zu merken, dass wir nicht alleine sind mit dieser Diagnose. Ebenso tut es uns gut, mit anderen «gesunden» Familien aus unserem Umfeld etwas zu unternehmen, und immer noch dazuzugehören.
Was wünscht Du allen Familien mit so einer Diagnose zu Weihnachten?
Weihnachten ist für mich das Fest des Lichtes, der Hoffnung, des Zusammenseins, vielleicht auch ein bisschen Erlösung. Ich wünsche allen betroffenen Familien, egal wo sie stehen mit ihrem krebserkrankten Kind, mit ihrem genesenen Kind oder ihrem Sternenkind, dass immer wieder Licht und Hoffnung da sind. Und dass sie geborgen sind in ihrem Umfeld und mitgetragen werden. Und ich möchte Familien ermutigen, dass sie konkrete Weihnachtswünsche an ihr Umfeld formulieren, die vielleicht nichts Materielles sind.